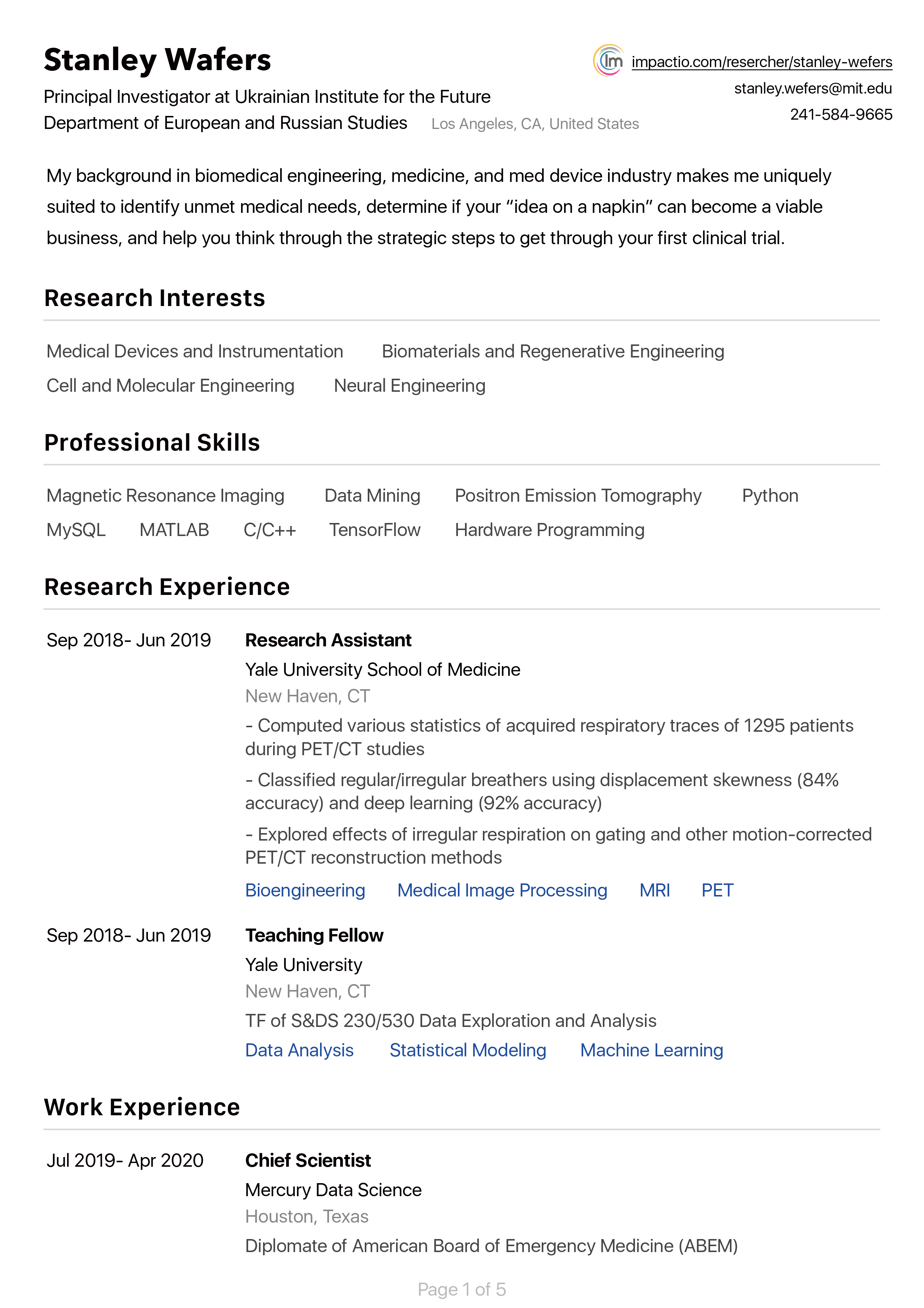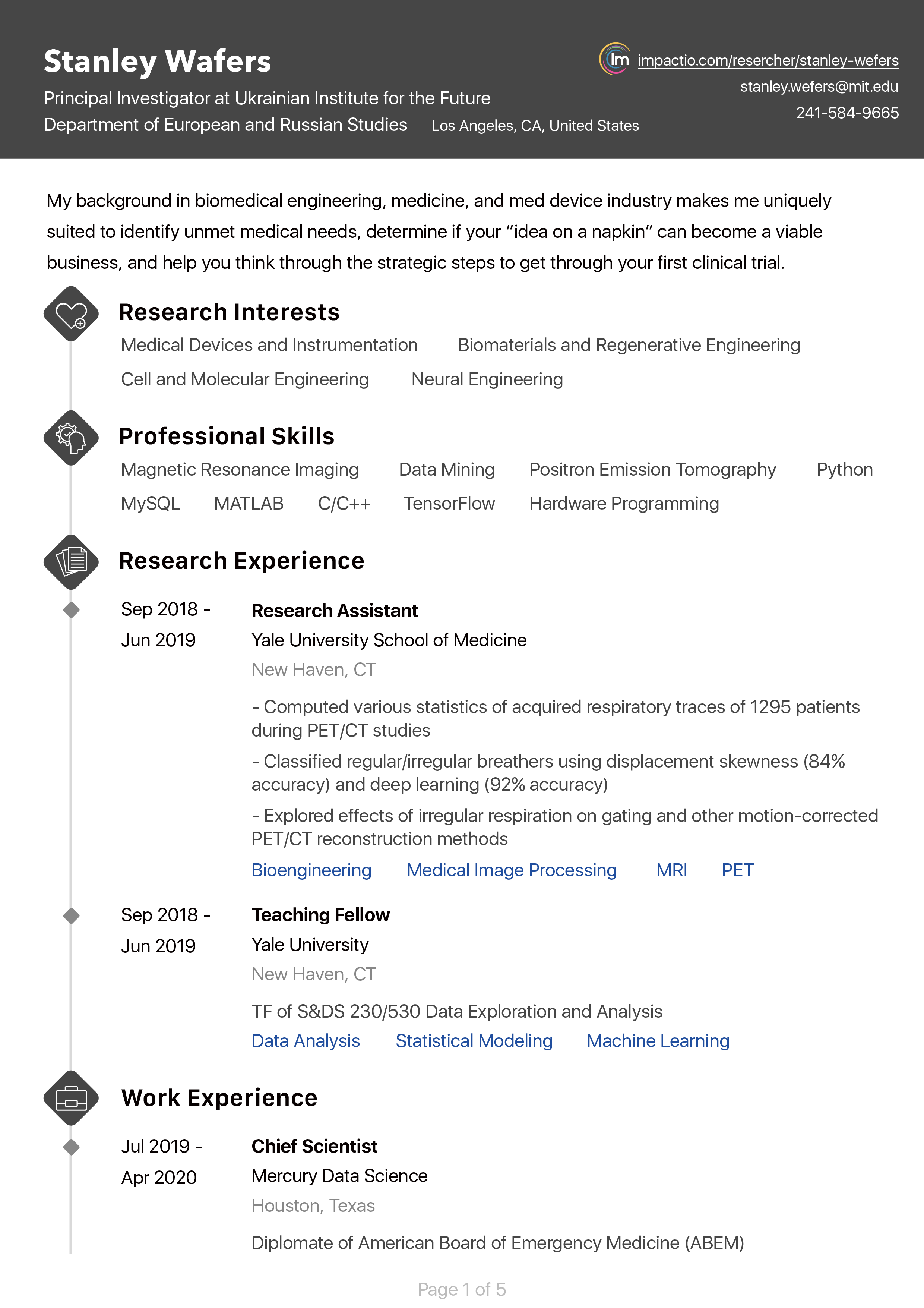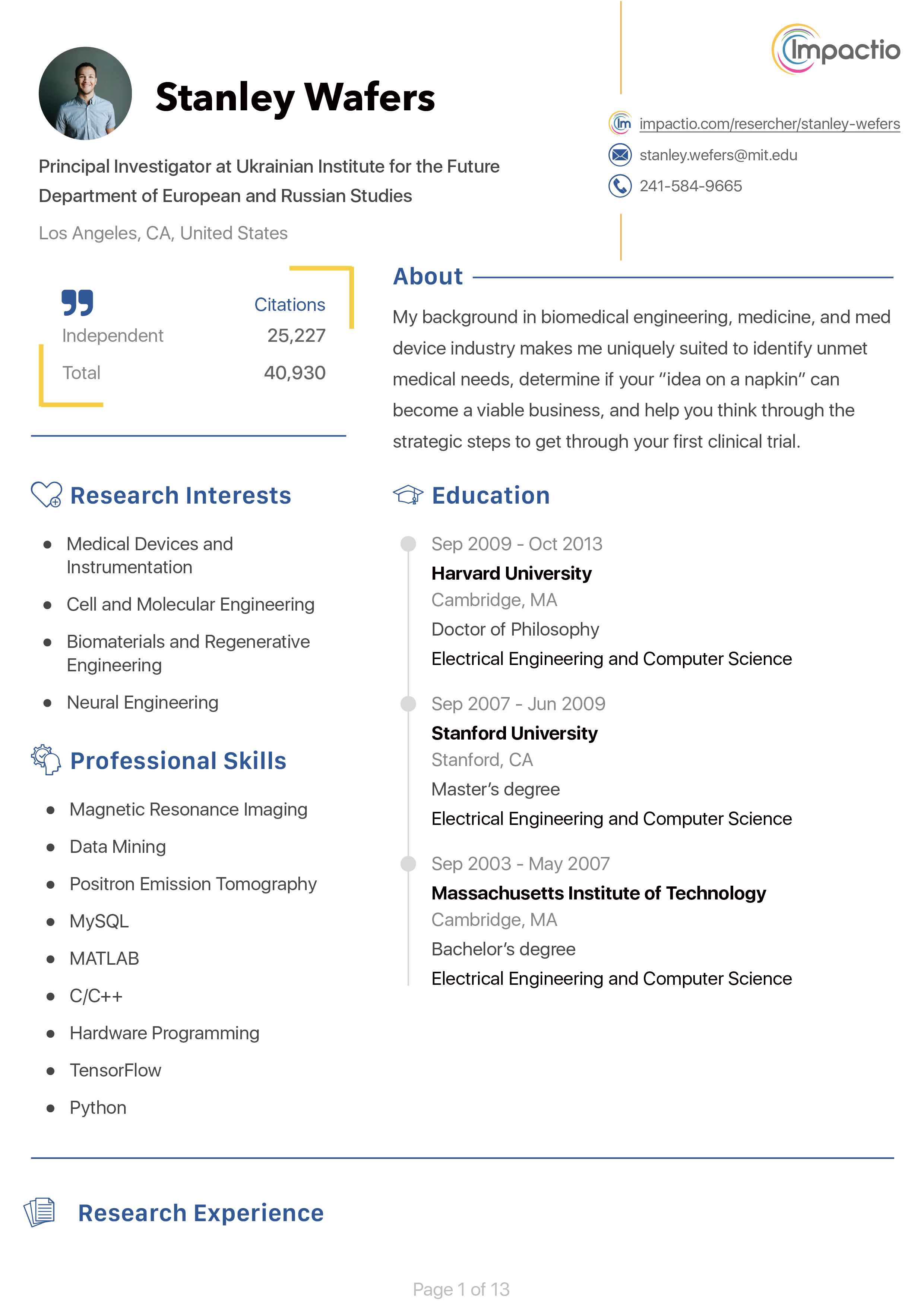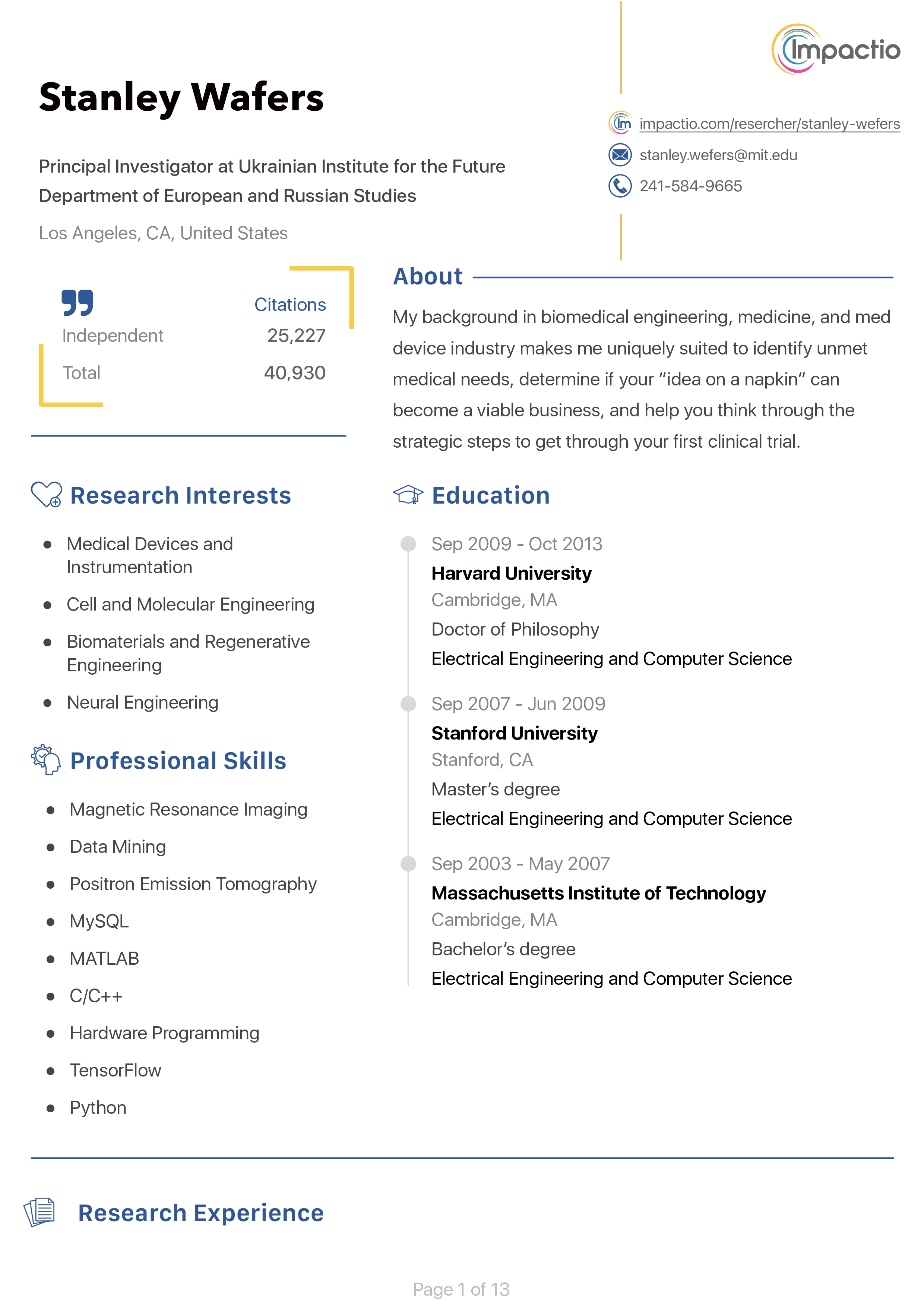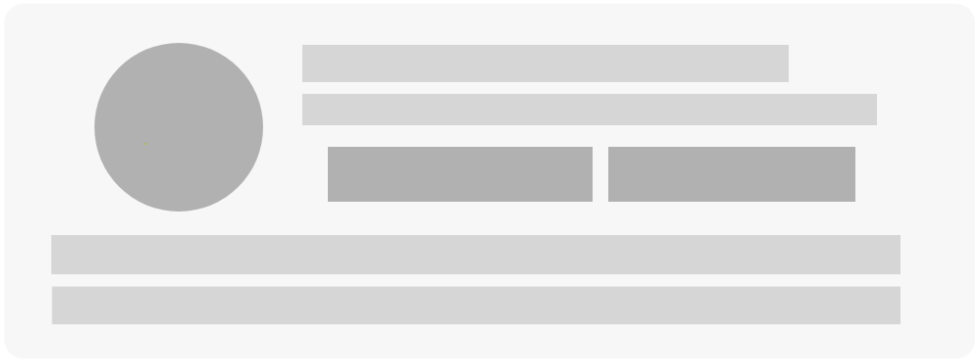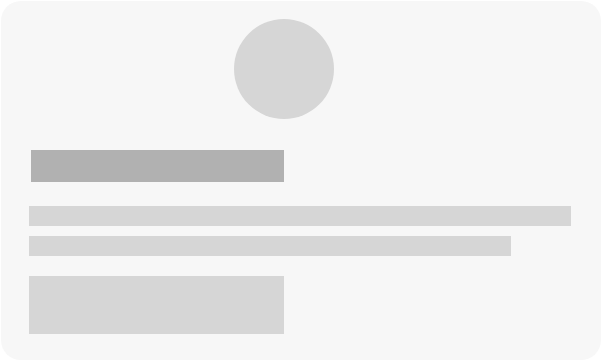PhD. Doctor of Laws, Germany / Harvard School of Government Exec Ed / Lawyer (EuRAG) & Lecturer in International Law & Political Sciences, Human Rights & Trade Union Law












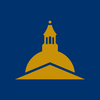




Zwar uns stehen viele Möglichkeiten für das fordernde Training des logischen Denkens und somit des Arbeitsgedächtnisses und der psychischen Gesundheit offen. Jedoch auch das Verständnis der Geschichte und des Zweckes des logischen Denkens kann dazu beitragen, die Zusammenhanglosigkeit in der Form des Schließens ausfindig zu machen und sie zu überwinden.
Welche positive Rolle kann das logische Denken im Alltag der Menschen spielen?
Am 6. Januar 2021 haben sich die EU und die VR China auf ein umstrittenes Investitionsabkommen geeinigt. Die EU unterstreicht ihre strategischen Interessen und Ziele auf der internationalen Bühne durch ihr internationales Handeln. Dieses soll seine politischen und wirtschaftlichen Beziehungen mit anderen Regionen und Staaten der Welt ausbauen und verbessern, unter anderem durch internationale Verträge mit seinen strategischen Partnern wie den USA, der VR China, Japan, Russland und Indien. Darüberhinausgehend soll es auch die Entwicklung, die Zusammenarbeit und den politischen Dialog mit Ländern des westlichen Balkans, Osteuropas, des Mittelmeerraums, des Nahen Ostens, Lateinamerikas, Zentralasiens, Ostasiens und des Pazifiks unterstützen.
Welche Kriterien sollen die EU-Außenpolitik in der aktuellen Welt im Umbruch orientieren? Wertvorstellungen oder Interessenabwägungen?
Soll die Förderung von Menschenrechten und Demokratie ein zentrale Aspekt sein?
Besteht es noch eine Hoffnung Einstellungswandel unserer wichtigsten Partner und Konkurrenten durch den EU-Außenhandel zu erreichen?
Mit der Schaffung des MERCOSUR – anfangs zwischen Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay, dann auch Venezuela – setzte sich eine Entwicklung ein, die Lateinamerika wirtschaftlich und politisch stärker miteinander verbinden sollte.
Dieser Weg ist seit 2016 in die Krise geraten.
Kahlschlag im Amazonas, De-Industrialisierung, Vertiefung der Ungleichheit und Armut, Lockerung von Waffengesetzen, Verharmlosung des "chinesischen Virus" als "kleine Grippe".
Wie können künftig Gesundheit gefördert, Ungleichheit reduziert sowie soziale Inklusion und Umweltschutz erreicht werden?
Bietet das neue Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem MERCOSUR eine nachhaltige Perspektive für die Zukunft der Region?
Das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (NAFTA) führte seit 1994 zum Aufstieg der Ausfuhr Mexikos, Zentralamerikas und der Karibik.
Mexiko wurde zur siebtgrößten Exportnation der Welt und hat seine Ölwirtschaft expandiert. Jedoch wurden neoliberale Dogmen positives Recht und entstanden NAFTA-Verfahren vor Schiedsgerichten mit Schadensersatzansprüchen an Regierungen in Höhe von mehreren Milliarden US-Dollar.
Die Länder der Region verwandelten sich von Selbstversorgern in Importländer Landwirtschaftsprodukte und die Migrationswelle in die USA ist mehr als zuvor gestiegen. Umweltprobleme, Drogenkartelle sowie Einkommensungleichheit verbreiten sich.
Die Corona-Krise stellt den Zusammenhalt dieser Länder in Frage. Welche Perspektiven eröffnen sich für die EU und für Deutschland in Zentralamerika und der Karibik nach dem Ausbruch der Corona-Rezession?
Welche Konsequenzen ergeben sich für Kuba und Venezuela aus der Aufrechterhaltung von den Sanktionen der USA?
Die Gründung der wirtschaftsstrategischen Pazifik-Allianz zwischen Chile, Peru, Kolumbien und Mexiko im Jahre 2012 förderte die Entwicklung und die internationalen Handelsbeziehungen in der lateinamerikanischen Pazifikküste, diesmal nicht nur zu den USA und Europa, sondern auch China, Japan und allen Ländern Asiens.
Jedoch befindet sich seit 2019 die Andenländer zwischen sozialem Umbruch, Bekämpfung der Corona-Rezession und Neuwahlen. Millionen Menschen gehen gegen Preiserhöhungen und soziale Ungerechtigkeit sowie für Menschenrechte und Achtung der Rechte der indigenen Völker auf die Straße.
Seither führten mächtige Protestaktionen zu Regierungswechseln und sogar neuen Verfassungen.
Eröffnet diese neue Lage in der Pazifik-Allianz und den Andenländern neue Chancen für einen grundlegenden Wandel und neue Partnerschaften – im Bereich der Wirtschaft und der Sozialpolitik, der Menschenrechte und des Umweltschutzes?
Mehr als eine Million Menschen gingen im Oktober 2019 in Chile gegen eine Preiserhöhung der U-Bahn-Tickets auf die Straße. Seither führten mächtige Protestaktionen gegen soziale Ungerechtigkeit, Machtmissbrauch und Missachtung der Rechte der indigenen Völker zu einer Regierungskrise und einem Plebiszit mit dem Ziel, die Verfassung aus der Zeit der Militärdiktatur zu ersetzen. Eröffnen die Wahlen 2021 neue Chancen für einen grundlegenden Wandel – im Bereich der Wirtschaft und der Sozialpolitik, der Menschenrechte und des Umweltschutzes? Im Rahmen der Vortragsreihe "Montags in Moosach".
"Die Vorstellung, dass alle Menschen frei und gleich an Würde und Rechten geboren sind, ist eines der wichtigsten Themen unserer Zeit. Das aber war in unserer Geschichte und ist auch heute in der Praxis keineswegs selbstverständlich. Menschenrechtsorganisationen listen immer noch regelmäßig Verstöße gegen die Menschenrechte in den verschiedenen Ländern der Welt wegen bewaffneter Konflikte, Vertiefung der Ungleichheit und Armut, Zerstörung der Umwelt, Flüchtlingskrise usw. auf. Wir begeben uns auf eine Reise um den Globus und fragen nach dem Ursprung unserer Vorstellung von Menschenwürde und Menschenrechten. Wir analysieren ihre Bedeutung für das tägliche Handeln sowie die Möglichkeiten, sie durchzusetzen. Wie sieht diese abstrakte Idee in der Realität aus und wie wird sie umgesetzt? Welche Rolle spielen Menschenrechte im politischen Alltag? Nach welchen Kriterien lässt sich die Lage der Menschenrechte beurteilen?"
Die Vorstellung, dass alle Menschen frei und gleich an Würde und Rechten geboren sind, steht in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Dies aber war in der Geschichte Russlands und ist auch heute noch keineswegs selbstverständlich.
Sowohl in der Zeit des zaristischen Russlands als auch in der Sowjetunion und der heutigen Russischen Föderation ist jedoch festzustellen, dass die Frage nach der bürgerlichen Gleichberechtigung und gesellschaftlichen Anerkennung der Menschen und Völker Russlands immer mehr an Wichtigkeit gewonnen hat und an einem Endpunkt noch lange nicht angelangt ist.
Nach welchen Kriterien lässt sich die Lage der Menschenrechte in Russland beurteilen?
Welche Herausforderungen präsentieren sich für eine europäische und insb. deutsche Zusammenarbeit mit Russland im Einklang mit der Einhaltung der Menschenrechte?
Dass alle Menschen frei und gleich an Würde geboren sind und Recht auf Arbeit, Gesundheit und Wohl haben, steht in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Dies war in der Geschichte Lateinamerikas und ist auch heute nicht selbstverständlich.
Seit den 1980er Jahren förderten die neuen Demokratien der Region den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt sowie die Menschenrechte.
Das veränderte sich jedoch erheblich im letzten Jahrzehnt - insb. Seit 2009 - durch Fragmentierung des Sozialstaates und politische Krisensymptome wie der Aufstieg von Ultrarechten, die Angst und Gewalt verbreiten sowie Menschen und Völker auseinandertreiben.
Vertiefung der Ungleichheit und Armut, Kahlschlag im Amazonas, Deindustrialisierung, Corona-Krise sowie die Lockerung von Waffengesetzen haben sich verbreitet und sind einige der Herausforderungen, die heute den Zusammenhalt der Länder mit zerstörerischen Folgen bedrohen.
Doch diese ungünstige politische Situation begann sich im Jahre 2019 konsistent zu verändern, als Andrés Manuel Lopez Obrador und Alberto Fernández die Präsidentschaftswahlen in Mexiko und Argentinien mit großem Sprung gewonnen haben und in Santiago de Chile mehr als eine Million Menschen im Oktober 2019 gegen eine Preiserhöhung der U-Bahn-Tickets auf die Straße gingen.
Seither führten mächtige Protestaktionen gegen soziale Ungerechtigkeit, Machtmissbrauch und Missachtung der Rechte der indigenen Völker zu Krisen und Niederlagen der ultrarechten Regierungen in Lateinamerika.
Eröffnen die Wahlen 2021 und 2022 in Lateinamerika neue Chancen für einen grundlegenden Wandel – im Bereich der Wirtschaft und der Sozialpolitik, der Menschenrechte und des Umweltschutzes?
Welche Perspektiven eröffnen sich für die EU und insbesondere für Deutschland in Lateinamerika nach dem Ausbruch der Corona-Rezession? Bieten das geplante Rahmenabkommen EU-MERCOSUR und das Lateinamerika-Konzept eine nachhaltige Perspektive für die Verbesserung der Lage der Menschenrechte in Lateinamerika? Welche Konsequenzen ergeben sich für Venezuela und Kuba aus der Verschärfung der Sanktionen der USA?
Im Interesse der Förderung einer solidarischen Kooperation zwischen Norden und Süden wollen wir gemeinsam diskutieren, wie soziale Gerechtigkeit, politische Partizipation und Umweltschutz in Lateinamerika die Würde und die Rechte der Menschen fördern können.
Vor mehr als 60 Jahren erklärten die USA ein Wirtschaftsembargo gegenüber Kuba. Die kubanische Regierung selbst spricht in diesem Zusammenhang von einer Blockade. Nach der kurzzeitigen Verbesserung der bilateralen Beziehungen unter US-Präsident Obama wurden die Maßnahmen gegen Kuba unter Präsident Trump erneut verschärft, und für die Regierung Biden scheint ein Politikwechsel gegenüber Kuba keine Priorität zu besitzen. Die extraterritorialen Maßnahmen der USA zeitigen nicht nur gegenüber Kuba erhebliche negative Effekte, sondern stellen auch für Banken, Unternehmen, NGOs und Privatpersonen in Europa und Deutschland ein großes Problem dar.
In der Diskussion setzten sich Dr. jur. Emilio Astuto (München), Prof. Dr. Susanne Gratius (Universidad Autónoma de Madrid), Dr. Sascha Lohmann (Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin) und Dr. Edgar Göll (Netzwerk Cuba – Informationsbüro, Berlin) mit unterschiedlichen Aspekten der Sanktionsmaßnahmen auseinander: ihrem Entstehungshintergrund und völkerrechtlichen Mekmalen, den extraterritorialen US-Sanktionen gegen Kuba, der EU-Politik des konstruktiven Engagements gegenüber Kuba sowie den Folgen der Sanktionen aus deutscher, europäischer und kubanischer Perspektive. Moderation: Dr. Peter Birle (IAI)
Prof. Dr. phil. Wolfgang Saggau, Volkswirt und Politologe / Dr. jur. Emilio Astuto, Dozent für Internationale Politik, Rechtsanwalt für Völker- und Menschenrechte / Sven Hilbig, Referent für Handelspolitik und Digitalisierung bei Brot für die Welt
Internationale Experten und Organisationen verweisen in ihren aktuellen Analysen darauf, dass die Kluft zwischen "Arm" und "Reich" rasant und überproportional stark angestiegen ist. Während viele Existenzen der "unteren Schichten" bis hin zur Mittelschicht insbesondere im Verlauf der Pandemie vielfach zerstört wurden, häuft sich Reichtum noch stärker bei denen, die vor der Corona-Pandemie bereits Millionäre bzw. Milliardäre waren. "So eine Krise wirkt wie ein Brennglas auf soziale Ungleichheiten", sagt Anja Piel, Vorstandsmitglied im Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB). Besonders die bereits Benachteiligten leiden am stärksten unter geschlossenen Kitas und Schulen, Kündigungen und den vielerorts verhängten Lockdowns. Was sind die Ursachen und Hintergründe dieser globalen Entwicklung?
In diesem Wochenseminar soll der Frage nach der Vermögensverteilung und dessen Entwicklung insbesondere während Krisenzeiten nachgegangen werden. Das Thema soll durch VertreterInnen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet und diskutiert werden. Nach einer allgemeinen Einführung zum Thema "Verteilungsgerechtigkeit" und "Soziale Sicherungssysteme weltweit im Vergleich" gehen wir auf "Spurensicherung" und analysieren anhand von aktuellen Studien, welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf die globale Vermögensverteilung und die bereits vulnerable Situation von benachteiligten Gesellschaftsschichten hat. Dabei wird jeweils zum einen die Situation in Deutschland und zum anderen globale Entwicklungen aufgezeigt und diskutiert.